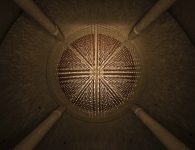Familienähnlichkeiten im Verhältnis von Kunst und Kirche von Thomas Erne
“Es ist eine Art perspektivische Verkürzung des Verstandes,“ sagte er sich „was diesen allabendlichen Frieden zustandebringt, der in seiner Erstreckung von einem zum andern Tag, das dauernde Gefühl eines mit sich selbst einverstandenen Lebens ergibt. Denn der Menge nach ist es ja bei weitem nicht die Hauptvoraussetzung des Glücks, Widerstände zu lösen, sondern sie verschwinden zu machen, und so, wie sich allenthalben die sichtbaren Verhältnisse für das Auge verschieben, daß ein von ihm beherrschtes Bild entsteht, worin das Dringende und Nahe groß erscheint, weiter weg aber selbst das Ungeheuerliche klein, Lücken sich schließen und endlich das Ganze eine ordentliche glatte Rundung erfährt, tun es eben auch die unsichtbaren Verhältnisse und werden vom Verstand und Gefühl derart verschoben, daß unbewußt etwas entsteht, worin man sich Herr im Hause fühlt. Diese Leistung ist es also,“ sagte sich Ulrich „die ich nicht in wünschenswerter Weise vollbringe.“ Robert Musil[1]
1. Vorbemerkung zu Thema und Gliederung[2]
„Wo finden wir Alexander Jawlenskys Kopfikonen? Wo Emil Noldes Abendmahl? Wo Ernst Barlachs Singende Mönche? Wo Max Beckmanns Kreuzabnahme? … Wo Kasimir Malewitschs Weißes Kreuz auf weißem Grund? Wo Barnett Newmans Kreuzwegstationen? Wo Arnulf Rainers Kreuze? Wo Werner Knaupps Kruzifixe? In den Kirchen? Nein. Wir finden sie in den Museen …“[3]. Wenn Kirche und Kunst getrennte Wege gehen, muss das noch kein Schaden sein. Werke moderner Kunst mit religiösem Inhalt sind in den Museen immerhin in Sicherheit – was man von ihnen in den Kirchen nicht immer behaupten kann. Auch die Klage, in der Moderne habe sich „Kunst und Kirche voneinander entfremdet“ und es gäbe einen „Exodus der bildenden Kunst der Moderne aus den Kirchengebäuden“[4] – falls die moderne Kunst dort jemals beheimatet war – ist noch kein dramatischer Befund. Die Wahrnehmung einer irreduziblen Mehrdimensionalität[5] von Kunst und Religion könnte für die Kirche mit Verlustängsten, aber auch mit gewissen Vorteilen verbunden sein.
Schwierig wird es offenbar erst dadurch, dass die Abgrenzung nicht trennscharf gelingen will. Der Kunst, so Eberhard Roters, ist nämlich nur die Kirche, nicht der Glaube abhanden gekommen. Religiöse Themen in den Werken zeitgenössischer Künstler sind daher kein Zufall. Die moderne Kunst scheint in ihrem Kern religiös bestimmt zu sein. Deshalb ähneln moderne Museen sakralen Räumen. Sie sind kein Sicherheitscontainer, sondern „zeitgenössische Kultorte, die Ähnlichkeiten aufweisen mit kirchlich-christlichen Ritualen und Liturgien“[6]. Susanne Natrup überschreibt ihren Aufsatz über das Museum als Ort impliziter Religion mit dem bezeichnenden Titel: „Ästhetische Andacht“[7].
In der Tat gibt es Ähnlichkeiten zwischen Kirche und moderner Kunst. Für nicht wenige Zeitgenossen, die sich am Sonntag in die Schlange vor dem Museum einreihen, sind beide gar zum Verwechseln ähnlich geworden. Und es sind nicht nur Äußerlichkeiten, etwa die Zitate antiker Tempelbauarchitektur in der Neuen Staatsgalerie in Stuttgart, die den Verdacht nähren, die Kirche sei durch Kunst ersetzbar. Die Kunst weitet sich in der Moderne zur Lebenskunst[8], zur ästhetischen Daseinsform, die wie die Religion beansprucht das ganze Leben zu rechtfertigen. Was also leistet die Kirche, was im Museum nicht auch, vielleicht sogar besser, gelänge?
Der Eindruck, die lebenspraktische Gestaltungskraft der Kirche ließe sich verlustfrei in eine ästhetische Daseinskunst überführen, könnte sich aber auch einer vorschnellen Deutung geistesgeschichtlicher Befunde[9] verdanken. Eine Deutung, die an Stelle von Ähnlichkeiten substanzielle Gleichheit setzt und die in der Kunst ausschließlich ein funktionales Äquivalent oder Substitut der Religion sieht. Ich möchte deshalb den Vorschlag machen, das Verhältnis von Kirche und Kunst weder als Diastase[10] und abstrakten Gegensatz noch als eine kulturtheologische Vermittlung[11] bzw. Transformation zu fassen, sondern als einen Fall von Familienähnlichkeiten. Es könnte sein, dass vieles ähnlich ist im Verhältnis von Kirche und Kunst, ähnlich, aber nicht gleich[12].
„Familienähnlichkeiten“ ist eine Metapher, die Ludwig Wittgenstein einführt, um Beziehungen zu beschreiben, die logisch oder substanziell nichts gemeinsam haben und die doch irgendwie zusammengehören. Kunst wird nicht dadurch religiös, dass sie sich christliche Symbole bedient. Die Religion wird nicht dadurch zur Kunst, dass sie religiösen Sinn in Zeichen darstellt. Und doch haben beide irgendetwas gemeinsam. Familienähnlichkeit, darauf legt Wittgenstein den größten Wert, ist ein deskriptive Kategorie. Es geht nicht um logische Gemeinsamkeiten. Familienähnlichkeiten erschließen sich nicht der begrifflichen Herleitung, sondern der Beobachtung.
Mit solchen Fragen nach Nähe und Distanz, Ähnlichkeit und Andersheit im Verhältnis von Kirche und Kunst befindet man sich inzwischen in bester Gesellschaft. Die Evangelische Kirche (EKD) in Deutschland hat 1999 zusammen mit den Vereinigten Evangelischen Freikirchen (VEF) ein Impulspapier unter der Überschrift „Gestaltung und Kritik“ veröffentlicht. Das Papier war als Einladung zu einem Konsultationsprozess „zum Verhältnis von Protestantismus und Kultur im neuen Jahrhundert“[13] gedacht – so der Untertitel – und es wandte sich an Künstler, Politiker, Theologen und Laien. Konsultationen in solchen Fragen setzen aber voraus, dass es im Verhältnis von Protestantismus und Kultur im neuen Jahrhundert auch Neues[14] zu entdecken gibt. Etwas, das in den bisher gängigen Alternativen – Religion oder Kultur bzw. Religion als Funktion der Kultur – nicht aufgeht.
Meine Ausgangsthese für das Verhältnis von Kirche und Kunst möchte ich kurz umreißen. Beide, Kirche und Kunst, haben es mit der Darstellung von Sinn mittels Zeichen, Symbolen, Gleichnissen, Bildern zu tun. Beide sind deshalb auch mit einem Konflikt konfrontiert, der sich mit der zeichenhaften Darstellung von Sinn einstellt. Damit ein Ausdruck lebendig bleibt, müssen alte Formen immer wieder abgelöst und abgebaut und neue Formen entwickelt und aufgebaut werden. „Formzerstörung und Formaufbau“[15] ist nach Ernst Cassirer die Formel für einen Grundkonflikt in kulturellen Symbolwelten, der in der Religion und in der Kunst in gesteigerter Bewusstheit dargestellt und bearbeitet wird. Darin sind sich Kirche und Kunst also ähnlich.
Aber, während die Kunst dazu neigt diesen Konflikt zu besänftigen und zu beschwichtigen, kann die Kirche von ihrem Zentrum her, dem Kreuz, die Gebrochenheit ihrer Darstellungsmedien nicht harmonisieren, und sie kann das auch nicht wollen. Darin sind Kirche und Kunst voneinander unterschieden.
Mit Kunst meine ich die ungegenständliche, so genannte abstrakte Malerei unserer Zeit, die sich im Unterschied zur abbildenden Malerei der Vergangenheit nicht als Vergegenwärtigung von etwas, sondern als ihre eigene Gegenwart versteht. Und mit Kirche meine ich einerseits die christlichen Symbole, Gottesdienstformen und äußere Zeichen, die sich als christlich verstehen und so auch von anderen verstanden werden (explizite Religion) und die andererseits auf ein inneres unsichtbares Zentrum bezogen sind, das in diesen äußeren sichtbaren Formen nicht aufgeht.
Zunächst geht es (2.) in einer Szene aus Musils Roman „Der Mann ohne Eigenschaften“ darum, das moderne Lebensgefühl in der Spannung von Riss und Rundung, Auflösung oder Aufbau von Lebensformen zu charakterisieren. Welche Rolle spielen Kirche und Kunst (3.) in diesem Spannungsfeld? Dann geht es um die Eigenart und Darstellungslogik der Kunst (4.) am Beispiel von Arnulf Rainers Kreuzübermalungen. Und dann um den Unterschied und die Familienähnlichkeiten (5.) im Verhältnis von Kirche und Kunst. Schließlich folgen (6.) einige Überlegungen zu den Folgen für die kirchliche Praxis.
2. Riss oder Rundung. Musils Beschreibung des modernen Lebensgefühls.
In Roberts Musils Romantorso „Der Mann ohne Eigenschaften“ geht die Hauptfigur Ulrich im Kapitel „Heimweg“[16] von einer festlichen Einladung durch die nächtliche Stadt nach Hause. Auf diesem „Heimweg“ erinnert sich Ulrich an seine Kindheit, an die überschaubaren Verhältnisse auf dem Lande, wo die Wiederkehr des Gleichen jedes Mal als ein neues Ereignis erlebt wird und deshalb die Götter noch bei den Menschen wohnen. Ein Heimweg ganz anderer Art zeichnet sich ab in das, was nach Ernst Bloch „allen in der Kindheit scheint und worin noch niemand war: Heimat.“[17]
Doch die Regression misslingt. Die Sehnsucht nach dem Lande bleibt ungestillt. Ulrich ist zu sehr Stadtmensch. „In der Stadt“, sagt er, “wo es tausendmal so viele Erlebnisse gibt, ist man nicht mehr imstande, sie in Beziehung zu sich zu bringen“[18]. Aber im Verlust schärft sich der Blick für das Verlorene. Deshalb entdeckt Ulrich aus der Distanz das Konstruktionsprinzip des einfachen Lebens, in das er nicht mehr zurückfindet. „Es ist eine Art perspektivischer Verkürzung des Verstandes“[19], meint Ulrich. Sie macht den meisten Menschen ein Dasein in Glück und Frieden möglich.
Gelingendes Leben ist eine Frage der Perspektive. Das Kleine groß und das Große klein, die private Welt in den Vordergrund und alles andere in den Hintergrund zu setzen, das ist die Ordnungsleistung, die Ulrich nicht mehr in genügendem Maße erbringt. Aber gerade deshalb begreift er ihr Geheimnis. Wie kann es gelingen, einem fragmentierten Leben den Schein von Ganzheit abzugewinnen? „Die meisten Menschen“, sagt Ulrich, „sind im Grundverhältnis zu sich selbst Erzähler“[20]. Sie ordnen ihr Leben, indem sie ihre widersprüchlichen Erfahrungen mit einem erzählerischen roten Faden durchschießen. Der Kunstgriff liegt dabei in den unscheinbaren temporalen Verknüpfungen. Sie bringen die disparaten Ereignisse in ein ordentliches Nacheinander und geben ihnen den Anschein der Notwendigkeit. Aus Fragmenten wird so ein Ganzes, aus Erlebnissen ein Lebenslauf.
Doch das Bindemittel, das „primitiv Epische“[21], kann brüchig werden. Dann fallen die Bilder aus der Fassung und das Dasein verliert seineRundung. Die Ganzheit zerlegt sich in eine perspektivische Vielfalt. Es gibt dann nicht mehr die Sprache, sondern Sprachen, nicht mehr eine Welt, sondern Welten, nicht mehr eine Kultur, sondern Kulturen. Es ist ein Leben im Plural.
Die Vervielfältigung der Möglichkeiten hat aber die Unbestimmtheit der eigenen Existenz zur Folge. Ein Mann ohne Eigenschaften – das ist Ulrich selbst. Immer an der Grenze, an der sowohl die genauen Grenzzieher, die Begriffe, wie auch die passgenauen und daseinsrundenden Bilder, konfrontiert mit der Möglichkeit, dass alles auch anders sein könnte, ihren Ort in einem ganzheitlichen Lebensentwurf verlieren.
Was Musil in seinem Roman 1930 so plastisch und prägnant beschreibt, ist inzwischen ein soziologischer Gemeinplatz. Wir leben in einer ausdifferenzierten Gesellschaft, in der wir den Gewinn an Möglichkeiten mit dem Verlust an überkommenen Ordnungen bezahlen. Das moderne Lebensgefühl lässt sich durch einen Mangel an Tiefe, an selbstverständlichen Gewissheiten charakterisieren: „Wertordnungen und Sinnbestände sind nicht mehr gemeinsamer Besitz aller Gesellschaftsmitglieder.“[22] Gleichwohl nimmt die Sinnkrise der Moderne nicht die dramatischen Formen an, die man angesichts des Verlusts eines gemeinsamen Fundaments erwarten könnte. Offenbar gelingt es der überwiegenden Zahl der Menschen, auch unter den Bedingungen ausdifferenzierter Lebensverhältnisse, die Ordnungsleistung zu erbringen, die Ulrich, dem Mann ohne Eigenschaften, abhanden gekommen sind. Sie beherrschen die Kunst eine Stimmigkeit im Kleinen zu erzeugen und trotz Globalisierung wie in einem Dorf zu leben. Es sind quasi autonomen Sinngemeinschaften, in denen man sich inmitten der neuen Unübersichtlichkeit als Herr im eigenen Hause fühlen kann.
3. Die Rolle von Kunst und Kirche?
Welche Rolle spielt die Kunst, welche die Kirche in der Transformation einer traditionalen in eine posttraditionale Gesellschaft, die mit der Szene aus Musils Jahrhundertroman angedeutet ist?
a) Formzerstörung und Formaufbau in der Kirche
Kirchen sind Orte der Geborgenheit, der vertrauten Traditionen und erwartungssicheren Ordnungen. Die Liturgie des Gottesdienstes, die Auslegung der Bibel in der Predigt tradiert einen Erzählzusammenhang, der identitätsstiftend ist in den Wechselfällen des Lebens und der das alltägliche Handeln orientiert. Kirche wird deshalb auch von konservativen Vertretern der Sozialtheorie als Kandidat für die religiöse Daseinsrundung gehandelt. Der Überzeugungskraft ihrer identitätsstiftenden Symbole könnte es gelingen, die „explosiven Gehalte der Moderne … kompensatorisch zu befrieden“[23]. Schon Ernst Troeltsch gebrauchte das Bild einer „elastisch gemachten Volkskirche“[24], die für die Vernetzung von unterschiedlichen Glaubens- und Lebensformen Sorge trägt. Wenn schon nicht mehr alle in einer Welt leben, dann wenigstens in einer „Welt der Welten“[25] – und nicht jeder nur in seiner Welt.
Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Der Erzählzusammenhang von Liturgie und Predigt bringt nicht nur das Ganze des menschlichen Daseins in einen Gesamtzusammenhang, der Anfang und Ende, das Höchste und das Niedrigste zusammensetzt. Im Zentrum der christlichen Kirche steht das Kreuz. Deshalb sind die christlichen Symbole nicht nur identitätsstiftend, sondern auch identitätskritisch. Die sichtbaren Formen der Liturgie, der christlichen Gemeinschaft, kurz, des christlichen Lebens, sie sind zugleich im Kern gebrochen, durchsetzt von Negativität. Die Kritik aller Bilder ins Bild gesetzt, so charakterisiert Adorno[26] das Kreuz in seiner Kierkegaardinterpretation. Die Identität, die der christliche Glaube stiftet, die Traditionen, in denen er sich ausdrückt und die Lebensformen, die er inspiriert, sie werden deshalb in der christlichen Kirche nicht nur gepflegt und geachtet, sondern auch und zugleich am Kreuz gewendet. Denn „perspektivische Verkürzungen“ entwickelt auch der Glaube, etwa Insidermentalitäten oder die Verfestigung einst lebendiger Rituale. Solche erstarrten Formen werden im Zentrum des christlichen Glaubens mit ihrer Auflösung konfrontiert.
b) Formzerstörung und Formaufbau in der Kunst
„Formaufbau und Formzerstörung“ bezieht sich auf Sinnbilder, in denen sich der christliche Glaube artikuliert, durch die er lebenspraktisch wirkt und die er, in ein und demselben geistigen Akt[27], immer wieder überschreitet. Solche Gebrochenheit der Darstellung wird aber auch der modernen Kunst zugeschrieben. Im Anschluss an Hegels These vom Ende der Kunst – Kunst ist nicht mehr die sinnliche Erscheinungsform des Absoluten. Sie ist nur noch Hinweis auf eine Wahrheit, über die sie nicht mehr verfügt[28] – wird argumentiert, die moderne Kunst habe in ihren radikalen und ästhetisch konsequenten Spielarten geradezu die Negation des Bildes zum Prinzip ihrer Darstellungen gemacht. In dieser Gebrochenheit ließen sich die ästhetischen Folgen des Christentums identifizieren. Sie lägen in der Erweiterung des antiken Kanons des Darstellungswürdigen durch die Kategorie des Hässlichen[29]. Ein solches Ideal von Schönheit, das Hässlichkeit in sich aufnimmt, sei im Anschluss an Hamann und Hegel, „nicht nur inhaltlich, sondern auch formal christlich bestimmt“[30]. Nicht nur Philosophen wie Theodor Adorno, sondern auch Theologen wie Joachim Ringleben sehen deshalb in einem „negativitätsdurchsetzten Ideal“ von Schönheit, das seinen eigenen Widerspruch, das Hässliche, Quälende und Verzweifelte in sich aufgenommen habe, den implizit christologischen Kern moderner Kunst.
Aber das ist noch nicht alles. Die Kunst in der Moderne ist nicht nur Kunst der Avantgarde, sondern auch populäre Kunst. Sie ist deshalb nicht nur an den Rissen des Daseins beteiligt, sondern auch an seiner Rundung. In ihren komplexen Werken destabilisiert sie unwahre Identitäten und in ihren populären Formen ist sie zugleich offen für die Darstellung lebensweltlicher Selbstverständlichkeit. Einerseits windet sie die Blicke heraus aus gewohnten Sichtweisen und arbeitet der perspektivischen Verkürzung entgegen. Andererseits ist sie als triviale Kunst in hohem Maße identitätsstiftend. Die Kunst der Avantgarde sucht das Offene, „die Lücke“[31], in der sie nicht mehr Abbild der Natur ist, sondern als Wirklichkeit ganz eigener Art aufscheint. Die populäre Kunst dagegen ist zirkulär. Sie überschreitet Grenzen nur, um sie zu sichern. Der kalkulierte Tabubruch, den es auch in der Lindenstraße um der Spannung willen gibt, dient letztlich dazu, so Robert Musil, dass „das Ganze am Ende seine ordentliche glatte Rundung erfährt“[32].
4. Christologischer Kern oder reine Bedeutsamkeit der Kunst?
„Sag nicht: Es muss ´Kirche` und ´Kunst` etwas gemeinsam sein, sonst hießen beide nicht ´Kultur`, sondern schau, ob ihnen etwas gemeinsam ist. Denn wenn du sie anschaust, wirst du zwar nichts sehen, was allen gemeinsam ist, aber du wirst Ähnlichkeiten, Verwandtschaften sehen. Wie gesagt: denk nicht, schau.“[33]
Was also gibt es zu Sehen im Verhältnis von Kirche und Kunst, wenn man die Suchbewegung aufnimmt, zu der Wittgenstein unter dem Titel „Familienähnlichkeiten“ so eindringlich einlädt? Anschauungsmöglichkeiten bietet das Werk des Malers Arnulf Rainer, der sich intensiv mit dem Kreuzmotiv auseinander gesetzt hat, so in dem Zyklus „Selbstkruzifikationen“ oder im Grünewaldzyklus von 1984-1989, in dem Rainer Motive von Matthias Grünewald überarbeitete.
Arnulf Rainer sagt in einem Interview, dass die Wahl des Kreuzmotivs nur Ausdruck seiner Phantasielosigkeit sei: „Aus Verlegenheit, als Einstieg greife ich dann anfangs zu diesem Bildzeichen.“[34] Die provokante Abgrenzung des Künstlers von der christlichen Religion, deren Symbole er verwendet, bringt das Selbstverständnis der modernen Kunst zum Ausdruck. Sie ist eine eigenständige, von Religion wie von anderen Symbolwelten prägnant unterschiedene Dimension der Kultur. Sie hat es zu tun mit Zeichen als Zeichen, Farbe als Farbe, Form als Form. Der Künstler sieht deshalb im Kreuz ein Bildzeichen – und weiter nichts. Genau das nehmen die christlichen Gesprächspartner einem Künstler wie Arnulf Rainer in der Regel nicht ab.
Nun könnte man ja einräumen, dass für einen Künstler die Wahl des Kreuzmotivs in der Tat nur Ausdruck seiner Verlegenheit ist. Ästhetisch ist es ein Zeichen wie Linie und Kreis. Tatsächlich bezieht sich das theologische Argument vom christologischen Kern moderner Kunst weniger auf die Inhalte, als vielmehr auf die formale Gestaltung. Im Vorgang, im Akt der Übermalung gegenständlicher Darstellungen, entdecken Philosophen und Theologen[35] etwas Wahlverwandtes im Verhältnis von moderner Kunst und Kirche. Denn, was Arnulf Rainer zeigt, das lässt sich als Bild der Kreuzigung eines Bildes deuten. Es sind Bilder der Negation des Bildes. Und nur der Umstand, dass diese Aufhebung des Bildes am Bild haftet, so das Argument, unterscheidet Arnulf Rainers Bildübermalungen von purer Destruktion.
Man kann sich also, was Arnulf Rainer ja suggeriert, die explizite Passionsdarstellung Grünewalds, die Gegenstand der Übermalung ist, wegdenken und die „latente Religiosität“[36] dieser Bilder in der Passion des Bildes selbst entdecken. Zugespitzt gesagt, während ein Maler wie Grünewald das Leiden Christi darstellt, versucht Arnulf Rainer dieses Leiden beim Betrachter auszulösen. Dazu bedarf es keiner expliziten Passionsdarstellung mehr. Die Passion fließt ein in die formale Gestaltung und bildet ihren impliziten christologischen Kern. Der Bezug auf die Christusdarstellungen eines Grünewalds besagt dann nur, dass auch noch dieser Übergang von der Darstellung der Passion zur Passion der Darstellung von Arnulf Rainer virtuos ins Bild gesetzt wird.
Arnulf Rainer selbst beschreibt den Vorgang der Übermalung allerdings ganz anders. Nicht als einen Akt der Destruktion, nicht als Durchkreuzen und Zerstören eines vorhandenen Bildes, sondern als ein Zudecken, eine Versenkung in jenes Bild, durch die es versinkt. „Der Bezug zur Tradition … ist immer nur eine Art Stufe. Durch … längere Bemalung, die ja eine Versenkung ist, können diese Devotionalien [Christusbilder] versinken.“[37] Nicht zufällig sind es mystische Kategorien, die Arnulf Rainer bemüht, um seine Intention zu verdeutlichen. Das gegenständliche Bild soll verschwinden und das Bewusstsein, aller inhaltsvollen Bilder entleert, nur noch auf die gleichsam konkrete Abstraktheit von Pinselstrich, Formintensität, Farbe, Fläche konzentriert werden. Oft verschwinden die traditionellen Bilder bei diesem Vorgang „gänzlich, oft nur beinahe“[38]. Je nach dem, wie stark sie übermalt werden müssen, um an ihnen die konkrete Abstraktheit von Pinselstreich, Fläche, Farbe, die nichts mehr bedeutet als Pinselstrich, Fläche, Farbe hervorzubringen.
Genau diese Oberflächlichkeit, die ein Kunstkritiker wie George Steiner[39] als Verlust an Tiefe beklagt, ist bei Licht betrachtet für den Künstler Arnulf Rainer der Gewinn, nicht die Krisis der modernen Kunst. Sie wird so zu derjenigen symbolischen Ausdrucksform, die nichts mehr bedeutet. Nichts in dem Sinn, dass ihre Werke auf nichts mehr verweisen als auf sich selbst. In dieser Konzentration auf die Oberfläche – man könnte auch in einem nicht abwertenden Sinn von Schein reden, das Zeichen als Zeichen, die Farbe als Farbe, die Fläche als Fläche – löst sich die Kunst der Moderne von ihrer metaphysischen Hintergrundsfundierung und gewinnt im Abschied vom Absoluten ihre ästhetische Autonomie.
5. Kunst und Kirche – ähnlich und doch anders
Die Übermalung des Gekreuzigten bei Arnulf Rainer hat in dieser Perspektive eine andere symbolische Bedeutung. Die Kunst findet zu ihrer ästhetischen Eigenständigkeit, indem sie den transzendenten Referenten – dafür steht das Kreuz – übermalt. Sie bringt also denjenigen Bezug zum Verschwinden, der sich einer Unterordnung unter den ästhetischen Ausdruck entzieht.
Genau diese „funktionale Unterordnung der Bezugnahme auf Objektives unter den Ausdruck“[40] begründet nach Matthias Jung die Autonomie und Eigenständigkeit der Kunst. Sie formiert sich allerdings in unterschiedlicher Reichweite. In der abstrakten Malerei oder in der reinen Zwölftonmusik eines Anton Webern radikalisiert sich die Unterordnung der externen Referenz in Richtung auf eine Selbstbezüglichkeit des ästhetischen Ausdrucks, in Richtung auf „das reine Bild als solches“, auf die Darstellung in ihrer „rein immanenten Bedeutsamkeit“[41]. Grüne Farbe ist kein Hinweis mehr auf Blumen, Wiese oder Wald, sondern nur auf die Qualität der Farbe Grün.
Aber auch für andere Kunstformen bis hin zu den populären Formaten gilt, dass die Beziehung auf reale Gegenstände, auf historische Personen und existierende Orte der poetischen Absicht dienen und dem ästhetischen Ausdruck unterworfen sind. Das macht den fiktionalen Charakter der Kunst aus. Die Tafelfreuden im Lübecker Haus Buddenbrooks sind zwar von Thomas Mann genau geschildert worden, aber wohl kaum, um die Rezepte[42] der Nachwelt zu überliefern, sondern um die großbürgerliche Atmosphäre im Hause Buddenbrooks möglichst plastisch vor Augen zu führen.
Anders ist es dagegen bei den religiösen Ausdrucksformen. Alle Symbole sind bezogen auf eine nicht erzeugte, sondern vorgegebene Wirklichkeit. In christlicher Sicht nehmen sie Bezug auf den transzendenten Referenten, in dem sich Gott offenbart. Insofern ist Christus das Bild der Bilder, die für den Glauben Gott repräsentieren, ohne dass Gott in diesen Repräsentationen aufginge. Aufgrund ihres christologischen Referenten sind alle Formen des religiösen Ausdrucks mit dem Konflikt von Formaufbau und Formabbau konfrontiert. Kein Zeichen von Gott kann im Blick auf Christus endgültig und erschöpfend sein, wiewohl es ohne solche Zeichen von Gott keine Gotteserfahrung gibt. Dass also von Gott immer mehr zu sagen ist als das, was von ihm gerade gesagt werden kann, besagt, dass jedes Zeichen für Gott hinter dem zurückbleibt, was es repräsentiert.
Das ist der positive Sinn[43] des Bilderverbots und seiner christologischen Präzisierung, auf diesen Überschuss an Sinn in jedem religiösen Ausdruck aufmerksam zu machen. Es gibt in Bezug auf Gott ein Reservoir des Nochnichtgesagten, das durch keine Symbolisierung Gottes erschöpfend dargestellt werden kann, aber das nur an Zeichen, Bildern, Worten als nicht zu erschöpfendes Mehr aller Zeichen erscheinen kann. Und deshalb bedarf es des beständigen Abbaus und Aufbaus religiöser Ausdrucksformen.
Ähnlich ist der Konflikt an dem Kunst wie Kirche partizipieren. Beide haben es mit der Darstellung von Sinn in Zeichen zu tun. Beide kennen die Erfahrung, dass Formen vergehen und neu entstehen müssen. Aber anders als die Kirche tendiert die Kunst dazu diesen Konflikt „bloß zu beschwichtigen“[44], ihn zu übermalen und zu überdecken. Die ästhetische Rechtfertigung des Daseins kann auf dem Weg zu einer rein immanenten Bedeutsamkeit ihrer Rundung kaum entgehen[45]. Die schockierensten Werke der Kunst verlieren im Abstand der Zeit ihre Wirkung und werden historisch. Und selbst Schriftsteller wie Proust und Joyce, deren formale Kühnheiten alles „primitiv Epische“ zertrümmern, werden von Musil kritisiert, weil sie „etwas Aufgelöstes schildern, aber gerade so wie früher, wo man an die festen Konturen der Dinge geglaubt hat.“[46]
Der christliche Glaube dagegen entwickelt seine Einstellung zu den Zeichen und Symbolen, in denen sich der religiöse Sinn artikuliert, im Horizont des Anderseins Gottes. Der Sinnreichtum, der sich mit Gott verbindet, geht nicht auf in den Darstellungen und Zeichen, die diesen Reichtum vergegenwärtigen sollen. Die Kirche kann also überhaupt nicht anders als den Konflikt von Formzerstörung und Formaufbau, den die Kunst tendenziell zum Verschwinden bringt, in ihren Ausdrucksformen wach zu halten.
Indem der christliche Glaube so auch im Blick auf elementare Fragen der Darstellung ganz bei seiner Sache bleibt, wird er bedeutsam für andere kulturelle Symbolwelten, auch für die Kunst. Die Kirche ist dann zwar nicht mehr das Fundament einer pluralen Kultur, aber ein unverzichtbares Ferment[47] ihrer Lebendigkeit. Mit einem Bild von Ingolf U. Dalferth[48]: Die Kirche hält die kritische Erinnerung an diejenige Lücke wach, die in jedem endlichen Sinnhorizont mitgesetzt sein muss, damit dieser sich nicht als letzte Realität missversteht.
6. Folgen für die kirchliche Praxis
Der christliche Glaube in evangelischer Perspektive zeichnet sich nicht so sehr durch die Einführung neuer religiöser Symbole aus, sondern durch eine „veränderte Stellungnahme“[49] gegenüber allen Zeichen und Bilder. Der „protestantische“ Geist ist „gesteigerte Bewusstheit des Zeichens“[50], weil er die Zeichen, deren er sich bedient, im Bewusstsein von bestimmten Unterscheidungen gebraucht, etwa die zwischen Sagbarem und Unsagbarem, Darstellung und Dargestelltem, menschlichem und göttlichem Handeln.
Luther insistiert deshalb darauf, dass er nichts gegen die Bilder an sich habe, denn es komme auf ihren nützlichen und seligen Gebrauch an „Missbrauch und falsche Zuversicht an bilden habe ich alle zeit verdampt … Was aber nicht misbrauch ist, habe ich ymer lassen und heissen bleiben und halten, also das mans zu nützlichem und seligem brauch bringe.“[51] Der rechte Gebrauch der Bilder aber besteht darin, den Unterschied zwischen Bild und Sache in der Betrachtung von Bildern zu vollziehen und deshalb „… unsere Knie doch nicht mehr zu beugen“[52] vor einem Bilder von Gottvater oder Christus, sondern es zu gebrauchen „als Zeichen für ein Anderes, Umfassenderes, das sich an ihm und in ihm offenbart.“[53]
Wenn der christliche Glaube von seinem Zentrum her, dem Kreuz, eine solche gesteigerte Bewusstheit für die Notwendigkeit wie die Vorläufigkeit von Darstellungsformen entwickelt, dann stellt sich die Frage, wie stilbildend ist dies für die kirchliche Praxis? Wie innovativ ist die Kirche im Umgang mit ihren unbestrittenen institutionellen Gerinnungen, aber auch, wie achtsam mit dem Reichtum ihrer Tradition? Das eigenständige Profil einer evangelischen Frömmigkeitspraxis, also das, was nur die Kirche unverwechselbar gut kann, müsste sich in dem praktischen Wissen zeigen, dass das christliche Leben der tradierten Formen bedarf, und diese zugleich immer wieder überschreitenmuss, damit sie lebendig bleiben.
Auch eine evangelischeFrömmigkeitspraxis zeichnet sich, wie der Glaube insgesamt, nicht in erster Linie durch die Einführung immer neuer Gottesdienstformen und liturgischer Elemente aus, sondern durch die gesteigerte Bewusstheit im Umgang mit vorhandenen Traditionen. Diese Bewusstheit rechnet, um mit dem Bild von Musil zu reden, mit dem unvermeidlichen Konflikt zwischen Riss und Rundung, Ordnung und Spontaneität, Pflege der Tradition und ihrer Kritik, kurz, Auf- und Abbau der Formen, in denen sich das religiöse Leben tradiert und entfaltet.
Das dynamische Moment, das so einer evangelischen Frömmigkeitspraxis von ihrem stilbildenden Zentrum, dem Kreuz, zu Eigen ist, kann sich sowohl ins Chaotische kehren und jegliche äußere Form ablehnen, als auch ins Traditionalistische und jegliche Veränderung verhindern. Beispiele für beides ließen sich in Geschichte und Gegenwart der Kirche genügend finden.
Aber dieses mitunter ermüdende Dilemma ist nur die unvermeidliche Kehrseite einer Dynamik, auf die der Glaube in evangelischer Sicht nicht verzichten kann. Denn in dieser Gebrochenheit der Zeichen, dem Wissen um die Notwendigkeit und Vorläufigkeit aller Darstellungsformen im Horizont der Andersheit Gottes, kommt der christologische Kern in der kirchlichen Praxis zur Geltung. Der Mangel an Einheitlichkeit im Erscheinungsbild, der dem Protestantismus dann oft, etwa von katholischer Seite[54] kritisch vorgehalten wird, könnte bei Licht betrachtet ein protestantischer Vorzug sein und Ausdruck eines gesteigerten Problembewusstseins im Blick auf die Darstellungsformen des Glaubens.
Die Chance der Kirche im Dialog mit der Kunst besteht darin, dass sie sich in Ähnlichkeit und Differenz zur Kunst ihres eigenen Gestaltungsprinzips bewusst wird. Und ebenso profitiert die Kunst vom Gespräch mit einer Kirche, die selbstbewusst den Konflikt von Formaufbau und Formzerstörung als ihr genuines Gestaltungsprinzip vertritt. Denn auch die Kunst entgeht der harmonischen Rundung wie dem ästhetischen Eskapismus nur solange wie Kirche und Kunst nicht zum Verwechseln ähnlich sind.
[1] R. Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, herausgegeben von Adolf Frisé, Bände 1-2, Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 1981, 648-649.
[2] Der Text bietet, leicht überarbeitet, meine Tübinger Antrittsvorlesung am Aschermittwoch, den 13. Februar 2001.
[3] E. Roters, Die Bildwelt der Kunst als Herausforderung der Kirche, in: R. Beck/R. Volp/G. Schmirber (Hg.), Die Kunst und die Kirchen. Der Streit um die Bilder heute, München (Bruckmann) 1984, 13-24.
[4] Inken Mädler, Kirche und bildende Kunst der Moderne, Tübingen (Mohr Siebeck) 1997, 7.
[5] Die Mehrdimensionalitätsthese E. Cassirers wird von Philipp Stoellger produktiv weitergedacht, vgl. P. Stoellger, Die Metapher als Modell symbolischer Prägnanz, in: D.Korsch/E. Rudolph (Hg.), Die Prägnanz der Religion in der Kultur, Tübingen (Mohr Siebeck) 2000, 100-138.
[6] Susanne Natrup, Ästhetische Andacht. Das postmoderne Kunstmuseum als Ort individualisierter und impliziter Religion, in: J. Herrmann/A. Mertin/E. Valtink (Hrsg.), Die Gegenwart der Kunst in der Kunst der Gegenwart. Ästhetische und religiöse Erfahrung heute, München (Fink) 1998, 74.
[7] A. a. O. 73.
[8] Philosophisch wird das Thema Lebenskunst im Sinn einer Ästhetik der Existenz neu durchdacht von Wilhelm Schmid, Auf der Suche nach einer neuen Lebenskunst, Frankfurt am Main (Suhrkamp) 1991, außerdem: Rainer Marten, Lebenskunst, München (Fink) 1993; eine sozialphilosophische Perspektive bietet P. Kiwitz, Lebenswelt und Lebenskunst, München (Fink) 1986. Zur theologische Deutung des Lebenskunstbegriffs, vgl. Thomas Erne, Lebenskunst. Aneignung ästhetischer Erfahrung, Kampen/NL (Kok Pharos), 1994. Ein christlich inspiriertes Handbuch des Gelingens: Matthias Krieg (Hg.), Lebenskunst – Stücke für jeden Tag, Zürich (Theologischer Verlag Zürich), 1999.
[9] Th. Rentsch warnt ebenfalls „vor `substantialistischen´ Deutungen geistesgeschichtlicher Befunde“ und schlägt deshalb vor, die offenkundige Nähe von mythischen, ästhetischen und theologischen Diskursen als Zusammenhang von „bestimmten >Familienähnlichkeiten<“ zu fassen“ (Th. Rentsch, Der Augenblick des Schönen, in: J. Herrmann/A. Mertin/E. Valtink (Hrsg.), Die Gegenwart der Kunst in der Kunst der Gegenwart. Ästhetische und religiöse Erfahrung heute, München (Fink) 1998, 125f.) G. Gamm interpretiert dagegen Wittgensteins Begriff der Familienähnlichkeit nicht kulturtheoretisch, sondern erkenntnistheoretisch als eine rhetorische Vernetzung von Lebensphänomenen diesseits der Allgemeinheit des Begriffs (vgl. G. Gamm: Flucht aus der Kategorie, Frankfurt am Main (Suhrkamp) 1994, 341-347).
[10] So äußert sich etwa E. Brunner: „Das Reich Gottes ist in jedem Fall etwas völlig Kulturtranszendentes“ (E. Brunner, Christentum und Kultur, Zürich (Theologischer Verlag Zürich) 1979, 33).
[11] Vgl. die einschlägige Formel Tillichs: „Religion ist die Substanz der Kultur, und Kultur ist die Form der Religion“ (P. Tillich, Systematische Theologie Bd. III, Stuttgart 21978, 285).
[12] Vom Bewusstsein der „Verwandtschaft“ von Kunst und Religion, das eine „bleibende Differenz“ einschließt, spricht D. Korsch, Herrschaft der Poesie. Eine kategoriale Deutung von Stefan Georges Kunstreligion, in: V. Drehsen/W. Gräb/D. Korsch (Hg.), Protestantismus und Ästhetik. Religionskulturelle Transformationen am Beginn des 20. Jahrhunderts, Gütersloh (Gütersloher Verlagshaus) 2001, 123-144.
[13] VEF u. EKD (Hg.), Gestaltung und Kritik. Zum Verhältnis von Protestantismus und Kultur im neunen Jahrhundert, Frankfurt am Main./Hannover 1999. Inzwischen liegt auch die Kultur-Denkschrift der EKD vor: VEF u. EKD (Hg.), Räume der Begegnung. Religion und Kultur in evangelischer Perspektive, Gütersloh (Gütersloher Verlagshaus) 2002.
[14] Veränderungen im Verhältnis von Religion und Kultur, Kirche und Kunst binden auch die Aufmerksamkeit der wissenschaftlichen Theologie. Die Praktische Theologie hat ein großes Interesse an der zeitgenössischen Kunst entwickelt (vgl. Hans-Eckehard Bahr, Poiesis. Theologische Untersuchung der Kunst, Stuttgart (Evangelisches Verlagswerk Stuttgart) 1960; Rainer Volp, Das Kunstwerk als Symbol. Ein theologischer Beitrag zur Interpretation der bildenden Kunst, Göttingen (Gütersloher Verlagshaus) 1966; Albrecht Grözinger, Praktische Theologie und Ästhetik.Ein Beitrag zur Grundlegung der Praktischen Theologie, München (Kaiser) 1987) In dem Maße wie die Praktische Theologie die gelebte Religion zu ihrem Thema macht (vgl. Dietrich Rössler, Die Vernunft der Religion, München (Piper) 1976; Henning Luther (Religion und Alltag, Stuttgart (Radius) 1992; Wolf-Eckart Failing/Hans-Günter Heimbrock, Gelebte Religion wahrnehmen, Stuttgart (Kohlhammer) 1998; A. Grözinger/G. Pfleiderer (Hg.), Gelebte Religion als Programmbegriff Systematischer und Praktischer Theologie, Zürich 2002) und sich als eine Theorie der gegenwärtigen Lebenswelt und des Alltags der Religion entfaltet, weitete sich der Blick. Die partikularen Fragestellungen von Glaube und Ästhetik, Kirche und Kunst, Wort und Bild werden jetzt in im Horizont einer umfassenden Kulturhermeneutik verhandelt (vgl. Wilhelm Gräb, Lebensgeschichten, Lebensentwürfe, Sinndeutungen. Eine praktische Theologie gelebter Religion, Gütersloh (Chr. Kaiser/Gütersloher Verlagshaus) 1998; Wolfgang Steck (Praktische Theologie Bd. I, Stuttgart (Kohlhammer) 2000). Inzwischen gibt es auch ein erkennbares Interesse der Systematischen Theologie an Fragen der Verhältnisbestimmung von Protestantismus und Kultur, (vgl. Dietrich Korsch, Religion mit Stil, Tübingen (Mohr Siebeck) 1997; Michael Moxter, Kultur als Lebenswelt, Tübingen (Mohr Siebeck) 2000).
[15] Zur Bedeutung und Herkunft der Formel von „Formzerstörung und Formaufbau“ aus E. Cassirers Kulturphilosophie, vgl. M. Moxter, Formzerstörung und Formaufbau: Zur Unterscheidung von Mythos und Religion bei Ernst Cassirer, in: M. Jung/M. Moxter/Th. Schmidt (Hrsg.), Religionsphilosophie, Würzburg (echter) 2000, 165-181.
[16] Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, hrsg. v. Adolf Frisé. Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 1978, 647-654. Ulrich kommt von einer Abendeinladung bei Arnheim, einem ästhetisch gebildeten, preußischen Großindustriellen, der Walter Rathenau nachgebildet ist, vgl. Karl Corino, Musil. Leben und Werk in Bildern und Texten. Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 1988, 12.
[17] Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung. Gesamtausgabe Bd. 5. Frankfurt am Main (Suhrkamp) 1977, 1628.
[18] Robert Musil (Anm. 16), 649.
[19] Robert Musil, a. a. O. 648.
[20] Robert Musil, a. a. O. 650.
[21] Ebd.
[22] P. Berger/T. Luckmann, Modernität, Pluralismus und Sinnkrise, Gütersloh (Gütersloher Verlagshaus) 1995, 32.
[23] J. Habermas, Die neue Unübersichtlichkeit. Kleine politische Schriften V, Frankfurt am Main (Suhrkamp) 1985, 45.
[24] E. Troeltsch, Die Kirche im Leben der Gegenwart, in: Ders., Gesammelte Schriften, Bände 1-4, Aalen (Scientia) 1981, hier: Band 2, 105.
[25] H. Blumenberg, Wirklichkeiten in denen wir leben, Stuttgart (Reclam) 1986, 3.
[26] Die zentrale Stelle lautet: „Die originäre Erfahrung des Christentums bleibt danach für Kierkegaard ans Bild gebunden … Es [das Kreuz] hebt alle Kunst auf, ist >in künstlerischer Hinsicht unbedeutend< und dennoch selber Bild“ (Th. W. Adorno, Kierkegaard, Frankfurt am Main (Suhrkamp) 1974, 237f.).
[27] Vgl. E. Cassirer, Zur Metaphysik der symbolischen Formen. Nachgelassene Manuskripte und Texte Bd. 1, hrsg. v. J. Krois/O. Schwemmer, Hamburg [Verlag???] 1995, 19.
[28] Hegels Kunstauffassung rekonstruiert systematisch: D. Henrich, Kunst und Kunstphilosophie der Gegenwart. Überlegungen mit Rücksicht auf Hegel, in: W. Iser (Hg.) Immanente Ästhetik – Ästhetische Reflexion. Poetik und Hermeneutik Bd. 2, München (Fink) 1966, 11-32.
[29] Vgl. H.- R. Jauß, Die klassische und die christliche Rechtfertigung des Hässlichen in mittelalterlicher Literatur, in: H.-R. Jauß (Hrsg.), Die nicht mehr schönen Künste. Poetik und Hermeneutik Bd. 3, München (Fink) 1968, 143-168.
[30] Joachim Ringleben, Dornenkrone und Purpurmantel. Zu Bildern von Grünewald bis Paul Klee. Frankfurt am Main (Insel) 1996, S. 15. Zur theologischen Interpretation von Schönheit, vgl. Matthias Zeindler, Gott und das Schöne. Studien zur Theologie der Schönheit, Göttingen (Vandenhoeck und Ruprecht) 1993.
[31] Vgl. H.-M. Dober, Die Moderne wahrnehmen. Über Religion im Werk Walter Benjamins, Gütersloh (Gütersloher Verlagshaus) 2002, 121: „Das hat sie [die Kunst] mit der Religion gemeinsam, die eben nicht nur die Totalität der Erfahrung in Einheit, Ganzheit und Sinn repräsentiert, sondern auch die Lücke im Zusammenhang der Sinndeutung, das Fragmentarische und die Differenz.“ Zur Metapher „Gott als Lücke“, vgl. I. U. Dalferth, Weder Seinsgrund noch Armutszeugnis. Gott und „die philosophische Erregung dieses Jahrhunderts“, in: ders.: Gedeutete Gegenwart. Zur Wahrnehmung Gottes in den Erfahrungen der Zeit, Tübingen (Mohr Siebeck) 1997, 190f.
[32] R. Musil (Anm. 16), 649.
[33] Vgl. L. Wittgenstein, Logische Untersuchungen, Oxford/GB 1953, 32. Das Wittgensteins Zitat ist leicht variiert. Im Original nimmt Wittgenstein als Beispiel für Familienähnlichkeiten Spiele, Brettspiele, Ballspiele etc., nicht verschiedene Symbolwelten wie Kunst und Religion.
[34] F. Mennekes/J. Röhrig, Cruzifixus. Das Kreuz in der Kunst unserer Zeit, Freiburg (Herder), 1994, 114.
[35] Auch für A. Grözinger ist das Bilderverbot das Zentrum einer theologischen Ästhetik (vgl. A. Grözinger, Praktische Theologie und Ästhetik, München (Chr. Kaiser), 1987, 103f.). Zur Verwandtschaft von Bilderverbot und moderner Kunst, vgl. A. Mertin,Der allgemeine und der besondere Ikonoklasmus. Bilderstreit als Paradigma christlicher Kunsterfahrung, in: A.Mertin/H. Schwebel (Hg.), Kirche und moderne Kunst, Frankfurt am Main (Athenäum), 1988,146-168.
[36] J. Ringleben (Anm. 30), 18.
[37] Arnulf Rainer im Gespräch mit Johannes Röhrig, in: F. Mennekes/J. Röhrig, Cruzifixus. Das Kreuz in der Kunst unserer Zeit, Freiburg (Herder) 1994, 116
[38] ebd.
[39] G. Steiner, Von realer Gegenwart. Hat unser Sprechen Inhalt? München (Hanser) 1990, 296.
[40] M. Jung, Erfahrung und Religion. Grundzüge einer hermeneutisch-pragmatischen Religionsphilosophie, Freiburg (Alber) 1999, 385. Anders argumentiert E. Jüngel (vgl. E. Jüngel, „Auch das Schöne muß sterben“, in: Zeitschrift für Theologie und Kirche 81 (1984), 111), denn das Schöne ist beim ihm ein Zeichen, das entweder nota praesentis rei oder nota absentis rei sein kann, jedenfalls charakterisiert ist durch einen zweistelligen Zeichenbegriff. Es ist Zeichen (nota) für und im Bezug auf etwas anderes (res).
[41] M. Moxter, Formzerstörung und Formaufbau. Zur Unterscheidung von Mythos und Religion bei Ernst Cassirer, in: M. Jung/M. Moxter/Th. Schmid (Hrsg.), Religionsphilosophie. Historische Positionen und systematische Reflexionen, Würzburg (echter) 2000, 165-181.
[42] Vgl. Sybil Gräfin Schönfeldt, Bei Thomas Mann zu Tisch. Tafelfreuden im Lübecker Buddenbrookhaus, Zürich (Arche) 1995.
[43] A. Grözinger schlägt eine positive Deutung des Bilderverbotes vor, das er im Sinne der Präsentation des göttlichen Seins im Entzug begreift. Missverständlich ist allerdings die Formulierung, das biblische Bilderverbot sei „ein positives Bilderverbot“ (A. Grözinger, Praktische Theologie und Ästhetik, München (Chr. Kaiser) 1987, 132).
[44] M. Moxter, Formzerstörung und Formaufbau. Zu Unterscheidung von Mythos und Religion bei Ernst Cassirer, in: Religionsphilosophie, Würzburg (echter) 2000, 165-181, 178. Nach Moxter haftet an der Verhältnisbestimmung von Kunst und Religion bei Ernst Cassirer eine Zweideutigkeit, so dass unklar bleibt, ob Kunst den Formkonflikt der Religion überwindet, oder eben nur beruhigt und beschwichtigt.
[45] Christoph Menke sieht dagegen in der Kunst die vielleicht herausgehobenste Weise des Hervortretens von Transzendenz: „daß die Kunst die Religion, wenn auch nicht an ihre transzendente Wahrheit gebunden, sie doch in ihrem Bezug auf Transzendenz beerbe. Und zwar beerbe im Sinne … [von] Transzendenz der Religion als Transgression, d.h. in ihrer Haltung der Überschreitung aller menschlichen Wertungsgesichtspunkte“ (C. Menkes, Wozu Kunst? Georg Steiners Interpretation der Moderne, in: D. Neuhaus/A. Mertin (Hg.), Wie in einem Spiegel. Begegnungen von Kunst, Religion, Theologie und Ästhetik, Frankfurt am Main 1999, 144).Und diese Überschreitungsfunktion tritt in der Kunst „entlastet von Begründungsaufgaben, rein hervor“ (a. a. O. 146). Menke wendet Steiners Kritik ins Positive. Der reine Zeichenfluss an der Oberfläche der Erscheinung ist die bessere Transzendenz. Aber ist Transgression von Zeichen zu Zeichen überhaupt eine Form von Transzendenz, oder nicht doch letztlich ungebrochene Immanenz? Muss im absoluten Werden (Transgression) nicht auch das Absolute werden (Transzendenz)? Zu dieser (spekulativen) Umkehrung, vgl. J. Ringleben, Aneignung. Die spekulative Theologie Sören Kierkegaards, Berlin (de Gruyter)1983.
[46] K. Corino, Musil. Leben und Werk, Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 1988, 378f.
[47] Zur Formel „Vom Fundament zum Ferment“, vgl. T. Erne, Vom Fundament zum Ferment, in: J. Herrmann/A. Mertin/E. Valtink (Hrsg.), Die Gegenwart der Kunst in der Kunst der Gegenwart. Ästhetische und religiöse Erfahrung heute, München (Fink) 1998, 283-295; außerdem: P. Kiwitz, Lebenswelt und Lebenskunst. Perspektiven einer kritischen Theorie des sozialen Lebens, München (Fink) 1986, 95.
[48] I. U. Dalferth, Weder Seinsgrund noch Armutszeugnis. Gott und „die philosophische Erregung dieses Jahrhunderts“, in: ders.: Gedeutete Gegenwart. Zur Wahrnehmung Gottes in den Erfahrungen der Zeit, Tübingen (Mohr Siebeck) 1997, 190.
[49] J. Hädrich, Religionstheorie und Religionskritik in der Kulturphilosophie Ernst Cassirers, in: Korsch/Rudolph (Hg.), Die Prägnanz der Religion in der Kultur, Tübingen (Mohr Siebeck) 2000, 41.
[50] E. Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen Bd. 2, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 91994, 306.
[51] M. Luther, Ein betbüchlein mit eym Calender und Passional hübsch zu gericht, Kassel 1982 (1529), Vorrede (Text: WA 10/II, 458-470).
[52] G.W.F. Hegel, Ästhetik Bände I-II, hrsg. v. F. Bassenge, Berlin (Aufbau) 1985, hier: Bd. I, 110. Zu Bilderverbot und reformatorischer Bilderkritik, vgl. J. Rohls, „… unser Knie beugen wir doch nicht mehr.“, in: Zeitschrift für Theologie und Kirche 81 (1984), 322-351.
[53] E. Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen Bd. 2, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchhandlung) 91994, 138.
[54] Vgl. J. Dierken, Weder ´Kirche zweiter Klasse` noch ´kanonisierter Subjektivismus`. Für einen selbstbewußten Protestantismus im ökumenischen Dialog, in: F.W.Graf/D. Korsch (Hg.), Jenseits der Einheit. Protestantische Ansichten der Ökumene, Hannover 2001, 149-179. Dierken charakterisiert das katholische Gestaltungsprinzip als Entsprechungssequenz „die sich von der ursprünglichen Wahrheit über die ontologische Vorgängigkeit der Gesamtkirche mit Petrusdienst und Lehramt bis hin zu der institutionellen Kirchengestalt als Konkretion der Inkarnation überhaupt erstreckt.“ (a.a.O. 175). Protestantisch baut sich dagegen ein gestaltendes Prinzip über eine „Praxis des Unterscheidens zwischen Göttlichem und Menschlichem, zwischen Allgemeinem und Individuellen“ (ebd.) auf. Der protestantische Mangel an Einheitlichkeit im Erscheinungsbild ist als nicht zufällig, sondern Ausdruck „differenter Christentumstypen.“ (a.a.O. 176).
BEITRAGSBILD Zeichnung von Thomas Putze